Am 26. März 2009 trat die Behindertenrechtskonvention auch in Deutschland in Kraft. Diese hat es zum Ziel, allen Menschen ein uneingeschränktes Recht auf Teilhabe zu ermöglichen. Mit der Unterzeichnung der Behindertenrechtskonvention gewann auch die Inklusion an Schulen zunehmend an Bedeutung. Doch inwieweit wurde in den Bereichen der Lehreraus-, -fort- und –weiterbildung darauf reagiert? Dem möchte ich in diesem Blog nachgehen.
Heute ist inklusiver Unterricht Aufgabe aller Schulen, dementsprechend sind alle Lehrkräfte hiervon betroffen. Im Gespräch mit Lehrkräften kristallisiert sich jedoch oft schnell heraus, dass Inklusion nicht abgelehnt wird, deren Umsetzung aber zu schnell kam und jetzt überfordert. Die Staatsregierung hingegen argumentiert, man hätte an allen Stellschrauben der Lehreraus-, -fort- und –weiterbildung auf die Neuerungen reagiert. Wie sieht die Realität nun aus?

Dass Inklusion schon funktioniert, zeigt hier die Kooperationsklasse in Thüngersheim in vorbildlicher Art und Weise, wie ich mich selbst überzeugen konnte.
Im Bereich der Lehrerfortbildungen gibt es tatsächlich viele Angebote – auf zentraler Ebene ebenso, wie auf regionaler und schulinterner. Ich begrüße es, dass die angebotenen Fortbildungen für Lehrkräfte jede Ebene ansprechen – von Vertreterinnen und Vertretern der Schulaufsicht über Schulleiterkongresse, Kurse für Seminarleiterinnen und Seminarleiter, Schulpsychologen und Beratungslehrkräfte bis hin zu schulinternen Fortbildungen für Lehrkräfte vor Ort. Dies belegen auch die Zahlen der Staatsregierung. Während im Schuljahr 2010/2011 insgesamt nur 159 Fortbildungsveranstaltungen mit rund 3800 Teilnehmerplätzen auf zentraler oder regionaler Ebene zum Themenfeld „sonderpädagogische Förderung“ angeboten wurden, waren es im Kalenderjahr 2015 bereits über 290 Fortbildungen mit 7800 Teilnehmerplätzen. Dass sich die Zahl bis zum Jahr 2018 noch weiter erhöht hat, mag ich gar nicht bestreiten. Doch ein Problem wird in diesem Zuge totgeschwiegen: Aufgrund des Lehrermangels ist es immer weniger Lehrkräften möglich, überhaupt noch Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen. Schulpsychologen und Beratungslehrkräfte kommen mit den zugewiesenen Stunden oft mit ihrer eigenen Arbeit nicht voran und haben schlichtweg nicht die Möglichkeit. Die Mobilen Reserven waren auch in diesem Schuljahr wieder auf Unterkante genäht, Lehrer erkranken und die Unterrichtsversorgung kann vor allem an Grund- und Mittelschulen nicht immer aufrecht erhalten werden. Das erste, was nun gestrichen wird, sind Fortbildungsbesuche. Ein Widerspruch in sich, der meiner Meinung nach einmal mehr auf die falsche Lehrerbedarfsplanung des Kultusministeriums zurückzuführen ist!
In der universitären Lehrerausbildung hat man ebenfalls an Stellschrauben gedreht, um die Studierenden auf die Aufgaben der Inklusion vorzubereiten. Ein Beispiel hierfür ist die Implementierung des verpflichtenden Basismoduls „Inklusions- und Sonderpädagogik“ für Studierende aller Lehrämter, das Angebot freiwilliger zusätzlicher Qualifizierungsmöglichkeiten für Studierende und Lehrkräfte, die Weiterentwicklung der pädagogischen Qualifikation „Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf“ sowie das Angebot eines Zusatzstudiums zur sonderpädagogischen Qualifikation für das Lehramt an beruflichen Schulen. Leider werden diese Maßnahmen noch nicht an allen Universitäten in angemessenem Umfang angeboten. Außerdem stehen wir trotz dieser Neuerungen auch weiterhin vor der Herausforderung des Lehrermangels an Grund- und Mittel- sowie Förderschulen. Meiner Meinung nach muss grundsätzlich über die Lehrerausbildung nachgedacht und diese weiterentwickelt werden, wenn wir dem Lehrermangel an genannten Schularten begegnen und die Inklusion stemmen wollen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich zwar Bemühungen seitens der Staatsregierung erkennen lassen, diese jedoch längst nicht ausreichen. Inklusion muss weiter gedacht werden – und kann nicht übergestülpt werden. Und auch obgleich viele Lehrkräfte motiviert sind, sorgen die unzureichenden Fördermittel und Unterstützungsmöglichkeiten ebenso für Unmut, wie die weiterhin unterschiedliche Bezahlung von Lehrkräften im Grund- und Mittelschulbereich. Die Inklusion betrifft vor allem diese zwei Schularten, eine geringere Besoldung ist aufgrund der immer komplexer werdenden Aufgaben längst nicht mehr tragbar.
Ich bin ein Verfechter der Inklusion und habe während meiner Zeit als Mitglied des Arbeitskreises für Inklusion sowie im Bildungsausschuss immer wieder überragende Beispiele für deren Umsetzung gesehen, beispielsweise in Schweden. Umso erschreckender finde ich es, dass Bayern weiterhin die finanziellen und personellen Mittel zurück- und somit die Inklusion aufhält.

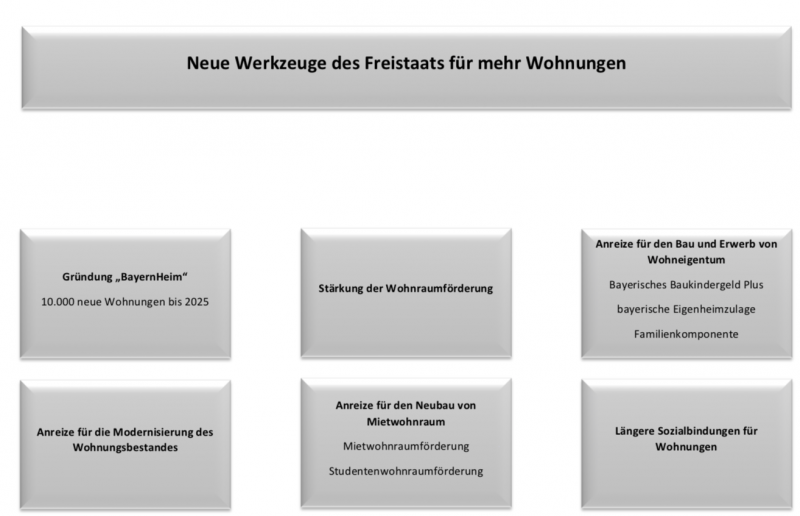

Neueste Kommentare